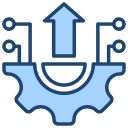Kosten, Zeit und Nutzen: Der Business‑Fall im direkten Vergleich
Berücksichtigen Sie neben Lizenzkosten auch Schulungen, Change‑Management, Integrationen, Hosting, Security‑Aufwand und spätere Erweiterungen. Low‑Code punktet oft bei komplexen Szenarien, No‑Code bei kleinerem Umfang. Schreiben Sie uns, welche Kostentreiber Sie in Ihrer Kalkulation sehen.
Kosten, Zeit und Nutzen: Der Business‑Fall im direkten Vergleich
No‑Code liefert häufig in Tagen ein brauchbares MVP, ideal für Validierungen. Low‑Code erreicht Stabilität und Skalierbarkeit, sobald Anforderungen wachsen. Erzählen Sie in den Kommentaren, wie schnell Sie erste Nutzer begeistern konnten und welche Hürden auftraten.