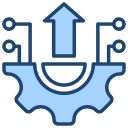Was Kosteneffizienz bei Low‑Code wirklich bedeutet
Low‑Code verschiebt Investitionen von großen Anfangsausgaben zu planbaren Betriebskosten. Dadurch lassen sich Risiken staffeln, Projekte schneller starten und Budgets flexibler steuern. Finanzteams erhalten Transparenz, während Fachbereiche ohne lange Freigabeschleifen liefern können.
Was Kosteneffizienz bei Low‑Code wirklich bedeutet
Lizenzen sind nur ein Teil der Rechnung. Entscheidend sind Entwicklungszeit, Change‑Kosten, Qualitätssicherung und Betrieb. Low‑Code reduziert Aufwände quer über diese Posten, weil Wiederverwendung, Vorlagen und visuelle Modellierung Fehler und Schleifen erheblich verringern.
Was Kosteneffizienz bei Low‑Code wirklich bedeutet
Wenn Fachleute Anforderungen direkt umsetzen, schrumpfen Übergaben und Wartezeiten. Diese gewonnene Produktivität ist bares Geld wert, weil sie frühere Nutzenrealisierung, weniger Nacharbeit und schnellere Lernschleifen ermöglicht – besonders in dynamischen Märkten.