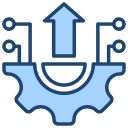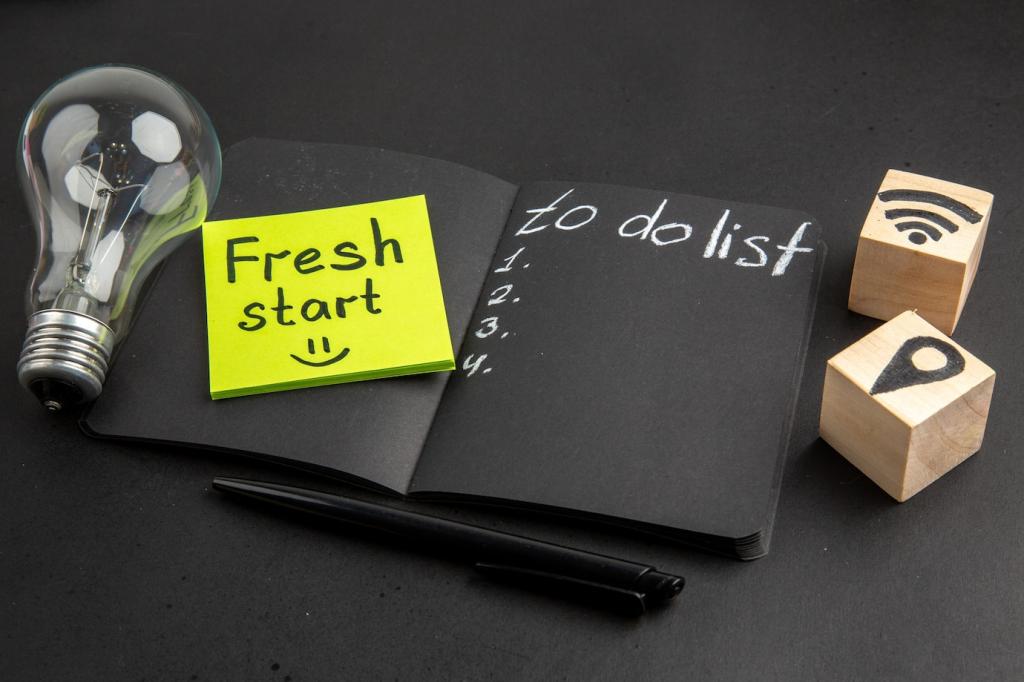Sichere Integrationen und APIs ohne Bauchschmerzen
Vergeben Sie kleinste Scopes, nutzen Sie PKCE für öffentliche Clients und vermeiden Sie langfristige Refresh Tokens ohne Rotationsstrategie. Dokumentieren Sie Callback‑URIs strikt und sperren Sie Wildcards, um Umleitungsangriffe zuverlässig zu verhindern.
Sichere Integrationen und APIs ohne Bauchschmerzen
Validieren Sie Signaturen, prüfen Sie Replays mit Nonces und speichern Sie nur notwendige Payloads. Rate‑Limiting und Idempotenz‑Keys verhindern Flutungen sowie doppelte Verarbeitung, besonders bei Fehlerspitzen oder absichtlichen Missbrauchsversuchen.
Sichere Integrationen und APIs ohne Bauchschmerzen
Geben Sie generische Fehlermeldungen nach außen, detaillierte Diagnosen nur intern. Maskieren Sie personenbezogene Informationen in Logs und verwenden Sie Korrelations‑IDs, damit Support helfen kann, ohne sensible Inhalte offenzulegen oder zu streuen.